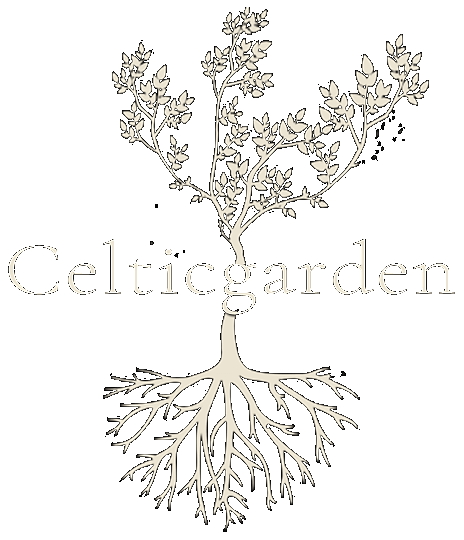Inhaltsverzeichnis
Aktualisiert am 23. November 2025
Himmelsbrand und Donnerkerze: Ein Riese im Wildgarten
In früheren Zeiten hat man mit der Königskerze das Wetter abgelesen. Diese Wildpflanze faszinierte unsere Vorfahren sehr, ob als Wetterorakel oder als „Blitzableiter“. Wohl wegen ihrer beachtlichen Größe und auch, dass sie kerzengerade in den Himmel ragt.
Manchmal hat sie eine kleine Neigung und wächst schief, was ich selber sehr gut in meinem Wildgarten beobachten kann, weil in diesem sehr viele Schwarze Königskerzen wild wachsen und sich jedes Jahr munter vermehren.
Die größte Königskerze, die ich gesehen habe, war in einer Sandgrube; sie war an die 3 Meter hoch. Leider stand sie nur ein paar Jahre dort und kam nie wieder. Nicht mal Ableger hat sie hinterlassen. Trotzdem war es sehr beeindruckend, vor ihr zu stehen.
Ihre volkskundlichen Namen sagen sehr viel aus, wie die Königskerze im Brauchtum unserer Vorfahren an Bedeutung hatte oder teils regionsbedingt noch hat.
Ihre Volksnamen sind: Wetterkerze, Himmelsbrand, Wollkraut, Goldblume, Donnerkerze, Blitzkerze, Himmelskerze, Johannislicht oder Fackelblume. Nur ein paar von ihren Eigennamen zu nennen. In ihnen sieht man, welchen Stellenwert diese Wildpflanze mal hatte. In manchen Regionen von Deutschland kam sie in die Mitte des Kräuterbündel, der alljährigen Kräuterweihe.

Im Zeichen der Blüten: Das Wetterorakel lesen
Um das Wetter abzulesen, wurde meistens die Kleinblütige Königskerze (Verbascum thapsus) genommen. Das Wetter für den kommenden Winter wird ab Mitte bis Ende Brachmonat (Juni) aus ihr ausgelesen. Also eigentlich dann, wenn sie in voller Blüte steht. Wir müssen aber darauf achten, dass sich das Wetter ein wenig verschoben hat. Man kann dabei mit 2 bis 3 Wochen rechnen (+/-).
Wenn zum Beispiel die Spitze der Königskerze nach Osten gebogen ist, kommt gutes Wetter. Nach Westen kommt schlechtes Wetter.
Wie die Anordnung der Blüten ist, so sieht man den voraussichtlichen Winter. Steht ein Kranz aus Blüten sehr tief am Stängel, so soll es einen sehr frühen Wintereinbruch geben. Wenn dann auf einen Blütenkranz gleich wieder kleine Blätter (siehe Grafik) erscheinen, so wird es nach dem ersten Schneefall nicht sehr viel und lange schneien.

Von Schneekränzen und Winterboten
Wenn ganz oben am Stängel sehr viele Blüten auf einmal aufgehen, dann wird es erst im Frühling schneien. An den vorhandenen Blütenkränzen kann die Anzahl der Schneefälle in dem Jahr vorausgesagt werden. In manchen Gegenden konnte daraus auch die Länge des Winters prophezeit werden.
- Viele Blütenkränze wird ein langer Winter.
- Wenige Blütenkränze ein kurzer Winter.
Auch wo die einzelnen Blüten am Stängel erscheinen, sagte etwas über die Dauer des Winters aus. Wenn die Pflanze am ganzen Stängel Blüten entwickelt, wird es ein langer Winter, wenn die Blüten nur vereinzelt am Stängel stehen, kommt ein kurzer Winter.
Stehen die Blüten am unteren Stängel sehr dicht beieinander, so wird die erste Dezemberhälfte sehr schneereich. Wenn sie aber dicht am oberen Stängel stehen, so kommt noch im Januar und Februar sehr viel Schnee.
Wenn die Königskerze sehr groß wird, so wird es ein sehr langer und strenger Winter; in Form von sehr viel Schneefall.
Der Dreiklang des Winters: Eine alte Rechnung
Eine andere Berechnung lautet, dass die Königskerze in drei Teile aufgeteilt wird:
- Winteranfang (unterer Teil)
- Wintermitte
- Winterende
Wie dort nun die reichlichen Blüten vorkommen, so wird das Wetter in dem jeweiligen Winterabschnitt. Also in einem 30-Tage-Rhythmus. Der Winter beginnt nach dieser Errechnung Mitte November und endet Mitte Februar. Das würde dann an einem Königskerzenstängel so aussehen:

Wenn dir mein Artikel gefallen hat und du meinen Blog Celticgarden unterstützen möchtest, würde ich mich um einen “Energieausgleich” sehr freuen. Ich bedanke mich im voraus!
Celticgarden unterstützen: