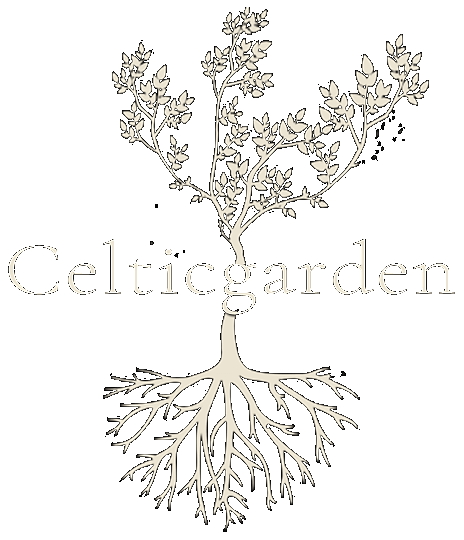Inhaltsverzeichnis
Aktualisiert am 8. Dezember 2025
Über den Wald und seinen Pilzen kann man so viel schreiben, weil es einen wahrhaften Schatz an Volksglauben gibt, der sich um ihn rankt. Darum habe ich euch hier eine kleine Zusammenstellung davon aufgelistet.
Des Waldes unheimliche Gaben: Pilze als Hexenwerk
Viele Pilze haben in ihrem Namen, das Wort Hexe. Wie zum Beispiel Hexenbutter, Hexenei und Hexenröhrling, nur ein paar aufgezählt von den „Hexenpilzen“. Die Menschen von damals haben die Pilze als schlechte Ausdünstungen des Waldes und als Hexenwerk angesehen. Wobei Pilze auch ihren Speiseplan bereicherten. Sie dachten, dass Pilze, die unter Nadelbäumen wuchsen, essbar seien und die Pilze, die unter Eichen und Buchen wuchsen, unbekömmlich waren.
Der Fliegenpilz gehört natürlich auch dazu. Es gibt so viel über ihn zu schreiben, dass er von mir einen eigenen Artikel bekommen hat. Es ranken sehr viele Mythen um den Fliegenpilz und sogar Räuchern kann man mit diesem alten Zauberpilz, der uns wohl alle fasziniert.
Hildegard von Bingen meinte Pilze aus dem Boden seien schädlich und Pilze an Bäumen haben Heilkräfte, wo sie nicht ganz unrecht hatte, da viele Heilpilze unter den Baumpilzen wachsen. Ganz besonders Baumpilze mit einer langen Tradition als Heilmittel sind zum Beispiel der Birkenporling, das Judasohr und der Goldgelbe Zitterling.

Rituale der Pilzsammler: Schutz & Zauberglaube
So meinte man in der Frühen Neuzeit, wenn ein Wald betreten wird, um Pilze zu suchen, sollte ein heidnisches Bannungszeichen, der Trudenfuß (ein Pentagramm mit der Spitze nach oben), mit der Fußspitze in die Erde gezeichnet werden. So sei man geschützt vor Gefahren und die Waldgeister sind dir hold und geben dir reichlich Pilze, aber du sollst den ersten essbaren Pilz, den du siehst, stehen lassen, als Opfergabe an sie.

Eine Pilzuhr basteln
Menschen im Spätmittelalter haben sich eine Pilzuhr gebastelt, indem sie einen Grashalm nahmen, der etwas länger als der Daumennagel der linken Hand war. Der Daumennagel wird mit seinem eigenen Speichel benetzt und der Grashalm darauf gelegt. Der Grashalm wird sofort die Richtung anzeigen, wo die Pilze stehen die man sucht.
Ein anderer Volksglaube besagt, dass man Brotkrümel im Wald verstreuen soll. Auch dann bekommt man von den Waldgeistern reichlich Pilze geschenkt.
Donars Segen: Der Pilztag
Um in die Pilze zu gehen, war der Donnerstag der beste Tag, weil er im heidnischen Brauch einer der heiligsten Tage war. Der Gott Donar war der Bauern- und Pilzgott.
Deshalb meinte man auch, wenn der erste Donner des Jahres vom Himmel stieg, dass man sich sofort auf die Erde schmeißen sollte und sich auf derselben Stelle herumwälzen musste. Egal wo man gerade war. Denn nur dann stand einem eine reichliche Pilzernte bevor. Der erste Donner im Jahr war auch das Zeichen, dass das Pilzesammeln nun losging. Daher war der Donnerstag ein Pilzsammeltag. Darum gingen viele Menschen, in damaliger Zeit, an einem Donnerstag, Pilze sammeln.
Genauso sollte man ungewaschen und in schäbiger Kleidung durch den Wald gehen, um seine Pilze zu finden.
Der Riesenbovist, so glaubte man, sei eine ausgebrannte Sternschnuppe. Manche Pilze wurden gesammelt, um Menschen zu schaden, wie zum Beispiel den Knollenblätterpilz.

Tanzplätze der Truden: Die magischen Hexenkreise
Dann waren da noch die Hexenkreise. Diese Pilzkreise waren kleine oder große im Kreis angeordnete Pilze. Diese Pilzkreise wurden auch Hexen- oder Trudentanzplätze genannt und man vermied sie, wo man nur konnte. Denn in ihnen kam man in die Anderswelt oder im schlimmsten Fall, gar nicht mehr heraus. Diese Pilze wurden nicht gesammelt und gegessen.
Aber auch Feenkreise wurden sie genannt und je nach Kultur waren sie positiv oder negativ angesehen. Die Feen tanzten ihre Mondtänze und durch diese Feentänze sind diese Pilzkreise entstanden. Mancherorts sah man in ihnen, dass sie durch einen Blitzeinschlag entstanden seien.
Nur bei Vollmond darf in diesen Hexenkreisen hineingegangen werden, aber nur wenn dieser Pilzkreis neunmal umgangen wurde. Aber auch der Teufel trieb sein Unwesen im Wald. Um ihn in den Griff zu bekommen und er einem nichts antun konnte, nahm man ein festsitzendes Grasbüschel und verknotete es, dann wurde es mit einem großen Stein beschwert, sodass es sich nicht mehr aufwinden konnte.
Die Hexenbutter: Magie der Gelben Lohblüte
Hexenbutter, als ich diesen Namen gelesen hatte, musste ich wissen um was es ging. Es ist die Hexenbutter (Fuligo septica) oder auch die Gelbe Lohblüte.
Ich habe die Hexenbutter in unseren zahlreichen Expeditionen quer durch Wälder per Zufall auf einen Baumstumpf gefunden und war gleich fasziniert von ihr. Dieser Pilz ist in der Lage hochgiftiges Zink in sich zu speichern und es macht ihm nichts aus.
Für mich also kein Wunder, dass sie aus dem Mittelalter, den Namen Hexenbutter bekam, weil die Menschen sowieso daran glaubten, dass der Wald das Reich der Hexen, Feen und Zauberer ist und wenn sie dann noch auf dieses Gebilde gestoßen waren, mussten sie bestimmt vor Angst erstarrt gewesen sein.
Man gab ihr den Namen Hexenbutter, weil man glaubte, dass die Hexen nachts die Kühe im Stall melkten und die Butter davon in den Wald nahmen und sie an ihren Versammlungsplätzen verteilten.
Ein anderer Volksglaube besagt, der Drache stiehlt wohl für seinen Herrn die Butter anderer Kühe. Wenn er damit über Dünger oder Lohe (Hexenbutter) fliegt, so lässt er die Butter fallen, denn Dünger und Lohe kann er nicht ausstehen. Diesen Schleimpilz, sammelten die damaligen Leute und schmierten damit die Wagenräder ein. So lange, dass nur noch etwas davon in der Radnabe befindet. So lange leidet die Hexe große Schmerzen.

Der Leichenfinger: Die Magie der Stinkmorchel
Auch wenn man es nicht glauben kann, aber als Hexenei ist die Stinkmorchel essbar. Als sogenanntes Hexenei ist dieser Pilz nicht giftig. Über die Stinkmorchel gibt es sehr viele Geschichten zu schreiben. Ihre Form gleicht einem Penis, dadurch auch ihr Name Phallus impudicus. Der Name bedeutet „Unzüchtiger Penis“. Ihren Geruch, der sehr stark nach Aas riecht, verströmt sie weit in den Wald hinein. Ihren penetranten Geruch kann man wortwörtlich „meilenweit gegen den Wind“ riechen. Ihre Hauptsaison ist meistens ab Spätsommer bis tief in den Herbst hinein.
Das Hexenei: Wann die Stinkmorchel essbar ist
Als Hexenei (woraus später mal dieser Pilz wächst) ist die Stinkmorchel für uns Menschen genießbar. Man kann das Hexenei roh oder gebraten verzehren. Dafür zieht man die Haut ab und schneidet das Hexenei in Scheiben. Dann kann es gebraten werden.
Ich selber habe es noch nicht ausprobiert, weil ich mich ein wenig Ekel vor diesem Pilz habe, auch wenn ich ihn sehr oft fotografiere und teilweise für die Fotografien vor ihm auf dem Waldboden liege. Ein erbärmlicher Gestank sage ich euch. Die unteren Fotos zeigen das Hexenei in verschiedenen Stadien des Wachstums.
Verschiedene Wachstumsstadien der Stinkmorchel
Wenn dieses Hexenei aufbricht ist die Stinkmorchel nicht mehr essbar, denn dann wächst in kürzester Zeit der Pilz heraus und besitzt zum Anfang noch eine grüne, schleimige Substanz an der Kappe. Diese grüne schleimige Substanz, auch Gleba genannt, wird von vielen Insekten besucht und gerne gegessen. Wobei der Pilz nicht ganz selbstlos ist und durch Anlockung der Insekten seine Verbreitung sichert. Denn in dieser schleimigen Substanz sitzen auch gleichzeitig seine Sporen.
Wofür die Stinkmorchel verwendet wurde
Ein Volksglaube besagt, dass dieser Pilz aphrodisierende Wirkungen besitzt. Wegen seiner Ähnlichkeit mit einem stehenden Penis verwendete man die Stinkmorchel, als Erregungsmittel, bei den Bauern Mitteleuropas. Es wurde mit der Stinkmorchel Liebeszauber betrieben, indem man den Pilz unters Essen mischte.
Dieser überaus stinkende Pilz wurde von den Slowenen getrocknet, pulverisiert, das Pulver auf schwarze Brandblasen gestreut und mit einem reinen Leinenstückchen überklebt. Dieses Pflaster lässt man eine Stunde lang liegen; dann wird es abgenommen und mit im Mund zwischen den Zähnen zerkauten Weizenkörnern belegt, damit die Blase heilt. Auch gegen Gicht soll dieser Pilz helfen.
Bei Tieren soll die Stinkmorchel abtreibend wirken.
Dieser Pilz liebt es, sich auf Gräbern niederzulassen und das war für die Menschen im Mittelalter eine Warnung des darunterliegenden Toten. Gerade wenn er eines unnatürlichen Todes oder durch eine Hinrichtung gestorben war. Es warnte die Menschen davor, das gleiche Schicksal zu bekommen. Nämlich den frühen Tod. Daher kommt der Name Leichenfinger!
Aus dem Zweiten Weltkrieg ist ein Brief von einem Soldaten bekannt, den er mit fünf Stinkmorcheln schrieb, die ihm Licht spendeten. Diese Pilze produzieren nicht sichtbare Strahlen, die einen Pappkarton durchdringen können, um darin eine Photoplatte zu beleuchten.

Wenn dir mein Artikel gefallen hat und du meinen Blog Celticgarden unterstützen möchtest, würde ich mich um einen “Energieausgleich” sehr freuen. Ich bedanke mich im voraus!
Celticgarden unterstützen: